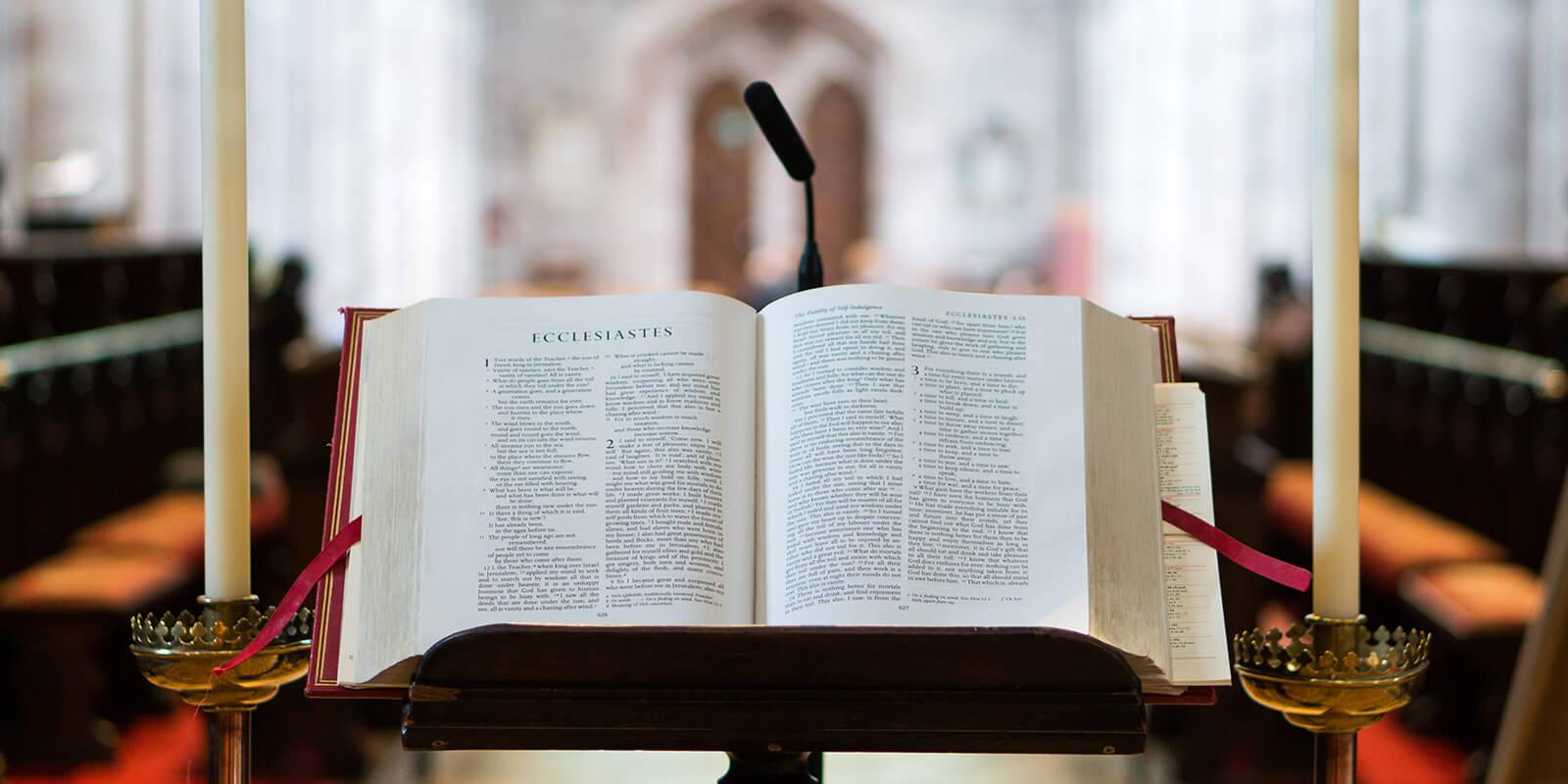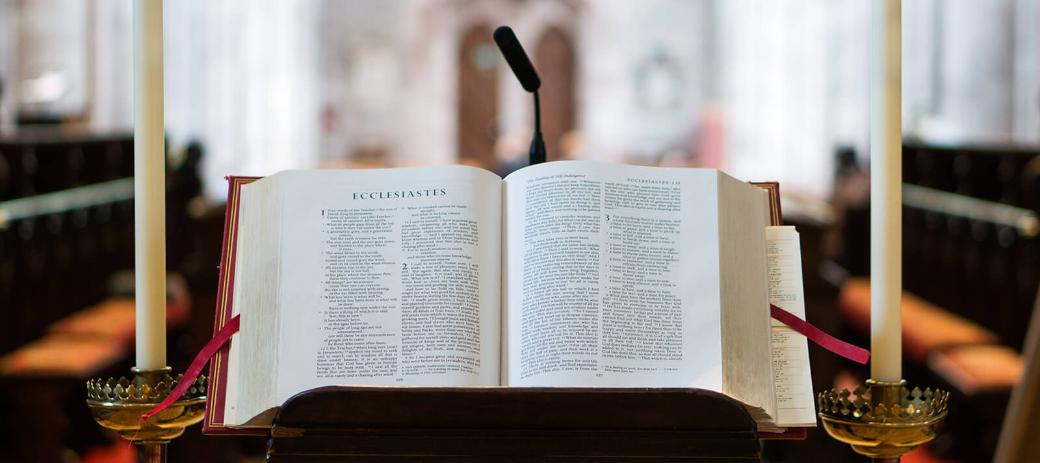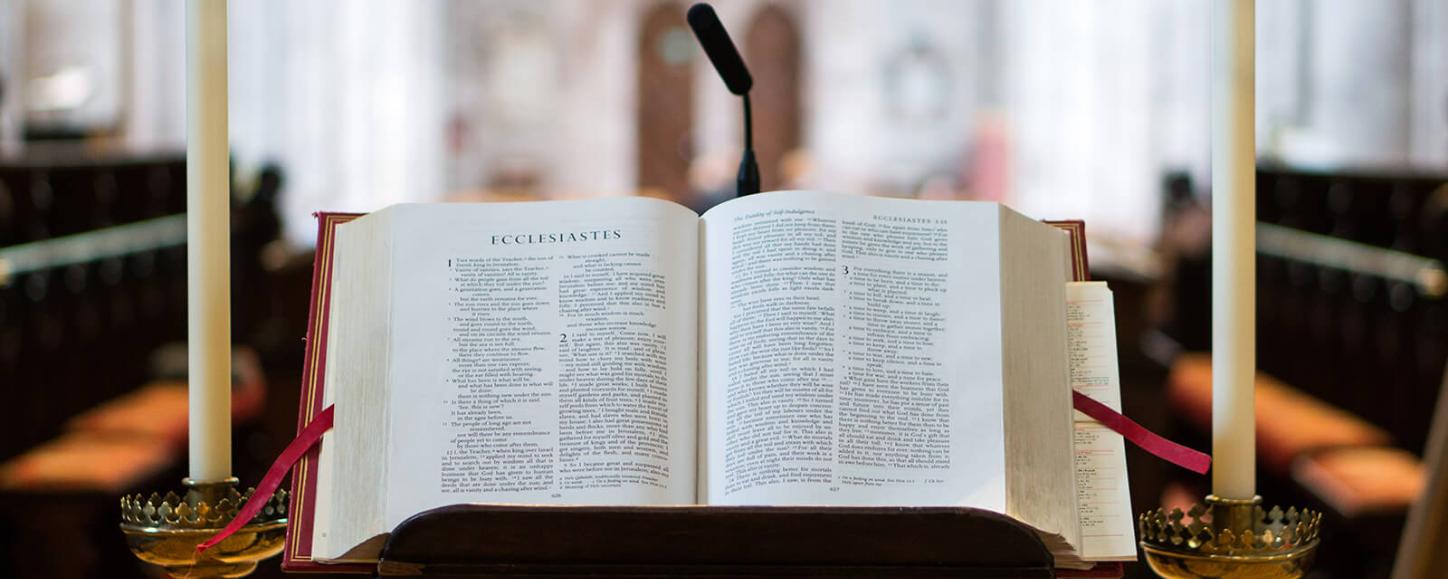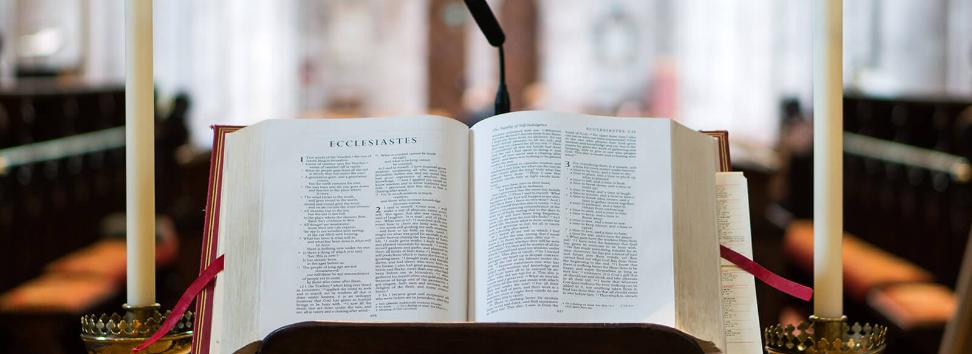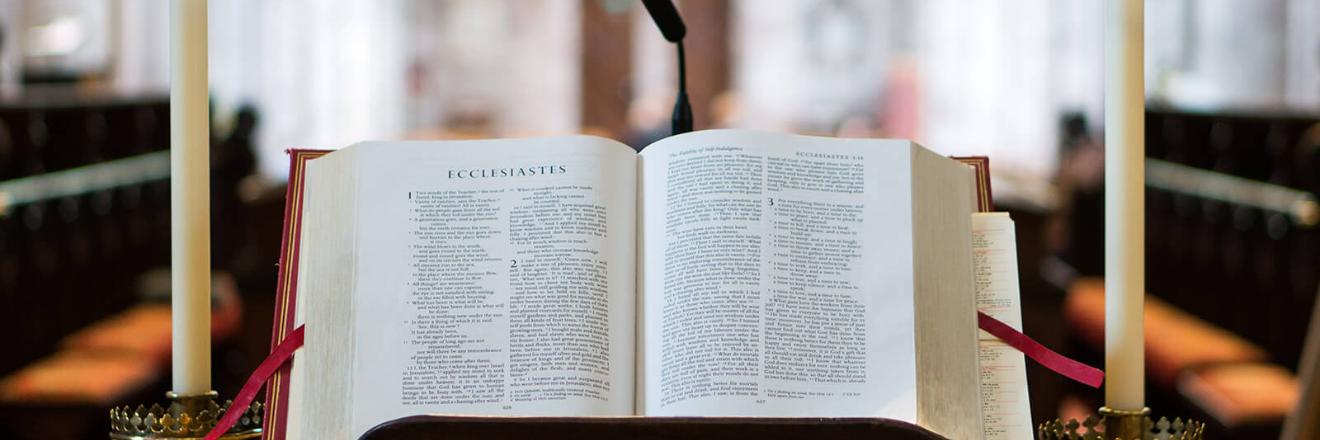"Die Ortskirche von Trier versteht sich inklusiv und setzt sich für Inklusion in der Gesellschaft ein."
Abschlussdokument der Synode im Bistum Trier "heraus gerufen" (2016), Anlage 2.2
Inklusiver werden kann gelingen, wenn gemeinsam Strukturen, Beziehungen und Gewohnheiten verändert werden. Dazu finden Sie hier Unterstützung für mehr Inklusion im Bistum Trier und darüber hinaus.